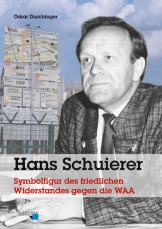Leseproben
"Kinder der Maxhütte"
Auszug aus:
"Wir sind Kinder der Maxhütte!"
Diese Aussage hat mich beeindruckt udn nachdenklich gemacht. Bei der Erstellung dieses Buches sind diese Worte von Ehemaligen und Zeitzeugen wiederholt gefallen.
"Wir sind Kinder der Maxhütte!"
Dies trifft in diesen gut 140 Jahren Werksgeschichte auf sicher jede Familie am Ort zu, weil über Generationen hinweg der Großvater, Vater und Onkel im Werk waren oder für das Werk gearbeitet haben,
sei es als Bäcker, Metzger, Handwerker, vom Mauerer bis zum Schreiner, von den Brauereien bis zum Busunternehmen.
So wurden aus 3500 Beschäftigten nochmal so viele, die vom Werk abhängig waren.
"Wir sind Kinder der Maxhütte!"
Diese Aussage trifft auch auf mich zu, weil das sichere Einkommen meines Vaters im Werk für ein ausgeglichenes Familienleben sorgte und damit auch eine gute Ausbildung der Kinder sicherte.
Es war auch die "Maxhütte", die mich 1980 als Leiter der Bauverwaltung unter Bürgermeister Hubert Humbs von der Stadtverwaltung Regensburg ins Rathaus nach Maxhütte-Haidhof führte.
Es war der 1. April, als ich meinen Dienst antrat. Für wahr, kein Aprilscherz, denn ich merkte schnell, auch im Bauamt, dass schwere
Zeiten angebrochen waren.
Kaum waren die Wunden der Gebietsreform 1972 mit der Eingemeindung von Leonberg,
Pirkensee und letztlich auch Ponholz verheilt, da tat sich ein unberechenbarer Schauplatz auf, bei dem die Register nicht im Rathaus gezogen wurden.
Zu der Sorge um die Arbeitsplätze im Werk kam die Sorgen um die Heimat, die von dem Schreckgespenst der Wiederaufarbeitungsanlage, der WAA, geprägt war.
Ganz sachte setzte sich die Meinung durch, dass sich Schwerindustrie und Wiederaufarbeitung nachbarschaftlich nicht vertragen. Und dann stand ja bekanntlich die WAA in Wackersdorf in Konkurrenz zum
gleichen Vorhaben in Niedersachsen und die Maxhütte im Ringen um öffentliche Fördermittel in Konkurrenz zur Georgsmarienhütte in Niedersachsen.
Es verging nahezu keine Stadtratssitzung, in der sich die Räte nicht mit dem Eisenwerk oder der WAA in Wackersdorf beschäftigen mussten. Dabei bestand im Stadtrat Einigkeit beim Werk, aber, wie auch
in der Bevölkerung, Uneinigkeit zum Thema WAA. Ich erinnere mich in dieser schweren Zeit an meine Mithilfe bei der Bewertung nicht betriebsnotwendiger Grundstücke des Werkes. Der Erlös von 52 Mio. DM
sollte, als Zuwendung des Freistaates, ein letzter Rettungsanker sein...
Mehr als 200 Millionen hatte das Werk für Sanierungen gefordert, aber nicht mehr erhalten. Die Maxhütte nicht, die Georgsmarienhütte in Niedersachsen sehr wohl. Die gibt es heute noch.
„Willle schafft Werke“ - steht über dem Eingang des
Rathauses. Übrigens der Wahlspruch von Bürgermeister Karl Schäffer, der als Arbeiter des Werkes und Betriebsrat ab 1945 bereits um den Erhalt des Werkes kämpfte und die Demontage verhinderte, sowie
das Rathaus und die Schule baute.
Ein starker Wille war sodann gefordert, als es darum ging, der Bevölkerung neuen Mut
zu geben und den guten Namen der Maxhütte, der Stadt Maxhütte-Haidhof zu erhalten...
"Die Suche nach dem Sauforster Gold"
Auszug aus:
Die Suche nach dem „Sauforster Gold“
In der 1928 herausgegebenen Festschrift „75 Jahre Eisenwerk“ beschreibt Eugen Roth die im Umgriff um das Eisenwerk Maximilianhütte entstandene Siedlung richtig enthusiastisch wie einen zweiten Garten
Eden und lässt in seinen Worten dort „Milch und Honig“ fließen. Auch wenn man Dichtern und Denkern „überströmende Phantasie“ generell zugesteht, kann und darf man eine derartige Lobpreisung des
Maxhüttengebiets im 19. bzw. frühen 20. Jahrhundert beim besten Willen nicht, als von künstlerischer Freiheit gedeckt, durchgehen lassen. Über die damalige Bevölkerung ist nämlich die durch die
Gründung der Maximilianshütte ausgelöste industrielle Revolution hereingebrochen, wie ein Orkan. Wie im Paradies fühlten sich die Einheimischen mit Sicherheit nicht, sondern eher so, als wären
sie in die tiefsten Tiefen der Hölle katapultiert worden. Hier ging es nämlich zu wie in einem südamerikanischen Goldgräbercamp. Von überall spülte es Glücksritter und Hasardeure
hierher, die sofort daran gingen, an allen Ecken und Enden die Erde aufzubrechen und das Innere nach außen zu kehren. Man suchte nach dem „Sauforster Gold,“ einer Braunkohlenspezies, bei der sich
leider herausstellen sollte, dass man sie um ein bis zwei Millionen Jahre zu früh dem Dornröschenschlaf entriss. Sie taugte jedenfalls nicht für die beabsichtige Produktion von
Eisenbahnschienen. Als man dies begriff, ließ sich die Uhr auch schon nicht mehr zurückstellen, denn das einmal begonnene „Werk“ trug den Namen des Königs und das durfte nur von Erfolg „gekrönt“
werden.
Den Preis zahlte, wie in allen Industrieregionen, die Heimat. Schon nach kurzer Zeit glich alles einer unwirtlichen Mondlandschaft. Riesige Kohlehaufen wechselten sich ab mit noch höheren Abraumhalden. Zur apokalyptischen Szenerie gehörten auch noch Teiche, in denen eine schmutzig-braune Brühe, das Grubenwasser, wabbelte. Das „Werk“ selbst, wie die Einheimischen ihr Eisenwerk kurz wie prägnant nannten, muss auf Menschen, die ja nur Ackerbau und Viehzucht kannten, gewirkt haben, als wäre ganz urplötzlich ein riesiger Drache erwacht, der ohrenbetäubende Geräusche ausstoßend aus unzähligen Öffnungen unentwegt Feuer, Rauch und Qualm spie. Eine gewaltige Dunstglocke sorgte dafür, dass man die Sonne nur mehr wie durch eine schmutzige Michglasscheibe wahrnahm. Wie Schnee rieselten ständig Ruß- und Staubpartikel auf die Erde nieder; tauchten sie aber nicht in Weiß, sondern in ein Grau-in-Grau. Im Sommer gesellte sich eine weitere Plage hinzu. Da fielen am Abend von den Kohleweihern auffliegende Mückenschwärme über Mensch und Tier her. Deren Stiche waren nicht nur schmerzhaft, sondern auch höchst infektiös.
Der Innere Betrieb des Werkes passte in den ersten Jahrzehnten wie die Faust auf das Auge zum äußeren Erscheinungsbild. Eine nach strengsten frühkapitalistischen
Grundsätzen geführte Unternehmensstrategie ließ keinen Platz für „Soziales“ und schon gar nicht für so was Abstraktes wie „Umweltschutz“.
Aber das „Werk“ ernährte eben 130 Jahre die Region. Die Menschen verziehen vieles und akzeptierten auch das, was eigentlich unakzeptabel war. Erst nach Jahrzehnten gelang es, so etwas wie
soziale Gerechtigkeit schicklich zu machen.
Es gehört zu den größten Verdiensten der Arbeiterschaft in härtesten Arbeitskämpfen, all jenes, was wir heute als unsere „sozialen Errungenschaften“ preisen, durchgesetzt zu
haben.
Ob sich die „Upperclass“, die Herren Direktoren, früher in den „schlossähnlichen“ Villen so recht wohlfühlten oder ob sie die parkähnlich angelegten Gärten wegen der Immissionen überhaupt genießen
konnten, darf mit Fug und Recht bezweifelt werden. Jedenfalls weiß man von einigen der Herren Kommerzienräte, dass sie am letzten Tag ihres Dienstes im Sauforst schon auf gepackten Koffern sitzend,
darauf warteten, dass ihnen die Ehrenbürgerurkunde ausgehändigt wurde.
Oskar Duschinger liest:
MP3-Audiodatei [34.0 MB]