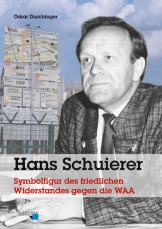Kriegsweihnacht 1942
Ein bissiger Nordostwind trieb die sich wütend auftürmende Gischt der Nordsee gegen die Kaimauer, während unser
Ausbildungsschiff in Wilhelmshaven einlief. Hier lagen auch zahlreiche deutsche Kriegsschiffe vor Anker, am Boden geschützt von einer Vielzahl an Flakgeschützen; in der Luft boten Fesselballons
Schutz feindlichen Tieffliegern.
Auf den Plätzen und Straßen von Wilhelmshaven wimmelte es nur so von Matrosen, die auf ihre nächste Feindfahrt warteten und sich bis dahin in düsteren Spelunken amüsierten.
Seit geraumer Zeit hatte ich mich vergeblich darum bemüht, Heimaturlaub zu bekommen. Um so glücklicher war ich, als ich nach meiner Ankunft in Wilhelmshaven erfuhr, dass man mir nun doch acht Tage Heimaturlaub genehmigt hatte und das in der Vorweihnachtszeit.
Meine Freude war derart groß, dass ich allen Drill, alle Qual, alle Ängste augenblicklich vergaß. Endlich wieder heim in die vertraute Heimat! Heim zu meinen Eltern, meinen Geschwistern, meinen Verwandten und Bekannten. Mich durchströmte ein wonniges Gefühl, das wohl nur derjenige empfinden kann, der Jahre lang Schlimmes ertragen musste.
Man schrieb das Jahr 1942. Es war Adventszeit, als ich zu Hause in der Heimat ankam - eine besinnliche Zeit. Meine Brüder und ich holten gemeinsam wie die Jahre vor meiner Einberufung aus der Greinseige das Tannengrün für unseren Adventskranz, den Mutter mit vier roten Kerzen schmückte. Ich empfand für einen Augenblick wieder jenes Gefühl der Seligkeit, das ich schon als Kind empfunden hatte, wenn die Kerzen ihr wärmendes Licht ausstrahlten, wenn im Kachelofen die Holzscheite knisterten und der Duft von feinen Bratäpfeln und Hutzeln meine Nase umschmeichelte.
Mutter machte extra feinen Kaffee und reichte uns dazu frisch gebackene Hefenudeln. Ich genoss jede Stunde meines Heimaturlaubs, denn es stand in den Sternen, ob ich nächstes Weihnachten noch erleben würde.
Wie immer, wenn Sitzweil-Zeit war, erzählte Vater auch an jenen Abenden meines Heimaturlaubs unheimliche Geschichten, die von schaurigen Gestalten handelten, die in den Rauhnächten ihr Unwesen trieben:
„Mitte Dezember ging abends der ,Dammer mit dem Hammer´ um. Deshalb wurden die Fensterläden schon früh geschlossen. Meistens ertönte der erste Hammerschlag zwischen 7 und 8 Uhr. Oft folgten noch mehrere Schläge mit unheimlichen Getöse hintendrein.
Furchterregend waren auch die Hoimänner. Fast immer begegneten einem diese Unholde bei Schneegestöber oder im Dämmerlicht des Waldes. Sie stanken zum Erbrechen nach Schwefel und Teer und ihre Teufelsfratzen waren gar widerlich anzuschauen. Dabei leuchteten ihre Augen wie rotglühende Kohlen. Wehe, man hatte kein Kleingeld bei sich, das man ihnen in letzter Not vor die Füße werfen konnte!
Zum Ende der Rauhnächte jagte das wilde Goich über Einöden und Dörfer.
Ihnen folgte die große Schar all der im letzten Jahr Verstorbenen. Mit wildem Geschrei schwirrten sie durch die Lüfte, vorneweg peitschenknallende Knechte mit ihren Pferden. Dazu hörte man Hähne krähen, Katzen schreien und Raben krächzen. Ein Geisterheer von Seelen mit der alten, kleinen Todesfrau hintendran. Wehe dem, der in dieser Nacht unterwegs war und dem wilden Goich begegnete! Warf sich dieser arme Mensch nicht auf der Stelle zu Boden, so riss ihn das wilde Goich mit sich. Glück hatte der, der irgendwo, weit abseits, wieder losgelassen wurde. Wem das Glück nicht hold war, dessen verlorene Seele zog für immer fort mit der Totenfrau..."
Die letzten Holzscheite verglühten allmählich im Kachelofen. Wieder verrann einer dieser herrlichen Urlaubstage in der Heimat. Es war schon seltsam. Erst jetzt war mir so richtig bewusst, wie sehr ich meine Heimat liebte, wie sehr ich an meiner vertrauten Umgebung hing.
Am Abend vor meinem Abschied zündete ich anstelle von Mutter die roten Kerzen des Adventskranzes an und wir sangen zusammen das Weihnachtslied: „Tauet Himmel, den Gerechten."
Mutter machte noch eine leckere Zwetschgenbrühe, dazu knusprig braune Hefenudeln; ein Gericht, das es sonst nur am Heiligen Abend gab.
Am nächsten Morgen marschierte mein Bruder Alfons mit mir zum Bahnhof. Den schweren Seesack hatte er mir abgenommen. Auf dem Bahnhofsgelände herrschte ein nervöses Gedränge. Der Zugführer mit seiner roten Mütze und dem breiten Schulterriemen stand majestätisch neben dem Zug und sah ständig auf die Uhr, damit ja der Fahrplan pünktlich eingehalten wurde. Ein schriller Pfiff ertönte. Abfahrt!
Schnaubend und dampfend setzte sich die Lokomotive in Bewegung. Meine Fahrt in eine ungewisse Zukunft begann. Würde ich meine Heimat je wiedersehen? Zum Glück begleitete mich mein Bruder Alfons bis zum Regensburger Hauptbahnhof. „Karl", sagte er aufmunternd, „ich werde deine frühere Arbeit mit übernehmen und as Kripperl besonders schön herrichten. Den Engel oben auf dem Stall werde ich schön mit Goldbronze bemalen. Eine Batterie für die Beleuchtung der Krippe habe ich schon besorgt. Moos und Wachholdersträucher hole ich aber erst einen Tag vor dem Heiligen Abend. Trotzdem wäre es mir lieber, wenn du mit uns feiern könntest!"
Dankbar strich ich meinem Bruder übers Haar. Wie gerne hätte ich das Weihnachtsfest 1942 zu Hause erlebt!
In Regensburg verließ mein Bruder den Zug. Er drückte mir zum Abschied beide Hände und machte mir Mut: „Wenn du heimkommst, holen wir alles nach!“ Ein letztes Winken, dann setzte sich die Lokomotive wieder schnaubend in Bewegung - Richtung Frontleitstelle. Ich schaute noch lange aus dem Zugfenster, bis mein Bruder meinem Blick entschwand. Keiner von uns beiden ahnte in diesem Moment, dass es unsere letzte Begegnung war - ein Abschied für immer.
Monoton ratterte der Zug durch die dunkle Nacht. Draußen schwebte ganz sacht wie weicher Flaum der Schnee vom Himmel. Viele Gedanken gingen mir durch den Kopf. Ich sah die besorgten Gesichter der Eltern und Geschwister vor mir und glaubte noch Mutters Tränen zu spüren.
Das dritte Kriegsweihnachten fern der Heimat nahte. Frühmorgens erreichte der Zug die Frontleitstelle, wo es nur so wimmelte von Soldaten aller Gattungen.
Mein neues Ziel war der Standort der Marine-Nachrichtenabteilung Gruppe West. Ein älterer, griesgrämig dreinschauender Oberfeldwebel kontrollierte meine Papiere. Sein Blick war scharf wie der eines Adlers. Verächtlich meinte er: „Ihr Paradematrosen rückt wohl jetzt erst in die Metropole Frankreichs ein? Erkämpfen mussten wir Infanteristen den Sieg."
Dann folgte eine knappe Anweisung: „Ihr Ziel, Soldat, ist Paris, la Garde du Nord!" Mürrisch presste er einen Stempel auf meine Papiere. Als ich nicht schnell genug weitermarschierte, grollte er: „Nun verschwinden Sie, sonst mach ich Ihnen Beine!"
Ich machte auf der Stelle eine Kehrtwendung und verschwand schleunigst in Richtung Ausgang.
Je näher ich Paris kam, desto unwohler fühle ich mich. Erschöpft schleppte mich meinen Seesack durch den Untergrund der Metrostation, wo es fürchterlich nach Knoblauch stank. Plötzlich sprach mich ein kleiner, verwahrlost aussehender Mann in gebrochenem Deutsch an. Gleichzeitig zog der Franzose eine Packung zerknitterter Nacktfotos aus seiner Hosentasche und lockte: „Nur fünf Francs!“ Ich lehnte dankend ab.
Hilfsbereit zeigte sich ein französischer Gendarm, den ich um Auskunft bat. Er nannte mir freundlich die Zielstation meiner U-Bahnfahrt und erläuterte mir die Strecke sogar auf dem Streckenplan der Metro. Zum ersten Mal im Leben fuhr ich mit einer U-Bahn und fand mich auf Anhieb zurecht.
An der Station „Molitor“ stieg ich aus und stand vor einem siebenstöckigen Gebäude, dem Hauptquartier der Marine-Nachrichtenabteilung Gruppe West. Hier trafen die Funksprüche aller deutschen Kampfschiffe ein, die im Mittelmeer, im Atlantik oder auf anderen Ozeanen operierten. Von hier aus wurden die neuesten Funksprüche zum Oberkommando-West (OKW) nach Berlin weitergeleitet. Meine neue Dienststelle war nicht im Entferntesten mit meinem letzten Einsatzort zu vergleichen. Hier bedurfte es nur eines einzigen unüberlegten Wortes, um vor dem Kriegsgericht zu landen.
Weihnachten stand unmittelbar vor der Tür. Rund um den Eifelturm und den
Triumphbogen war jedoch wenig von besinnlicher Weihnachtsstimmung zu spüren; stattdessen herrschten Trubel und Hektik. Im Stabsgebäude hingegen wurde für die Größen der deutschen Kriegsmarine, von
den bekannten U-Boot-Kommandanten bis hin zu den Generaladmirälen eine pompöse Weihnachtsfeier vorbereitet. Die Kombüse war mit fetten Gänsen, Enten, Puten und allerlei Getränken bestens versorgt.
Von Kriegsnot keine Spur! Während die mächtigen Kriegsstrategen schlemmten, blieb uns einfachen Soldaten der Mund wässrig.
Einen Tag vor dem Heiligen Abend wurde für die deutschen Truppen im Bereich der M.N.A. - West höchste Alarmstufe angeordnet. Die alliierten Truppenverbände hatten zu einer Landungsoperation angesetzt. Alle verfügbaren deutschen Soldaten wurden sofort mit Maschinengewehren und leichten Waffen ausgerüstet, um an der westlichen Kriegsfront den Feind zurückschlagen zu können. Doch nicht nur im Pariser Stabsgebäude wuchs die Nervosität. Fast an allen Fronten waren die deutschen Truppen unter wachsenden militärischen Druck geraten. An ein friedliches Weihnachtsfest war nicht mehr zu denken.